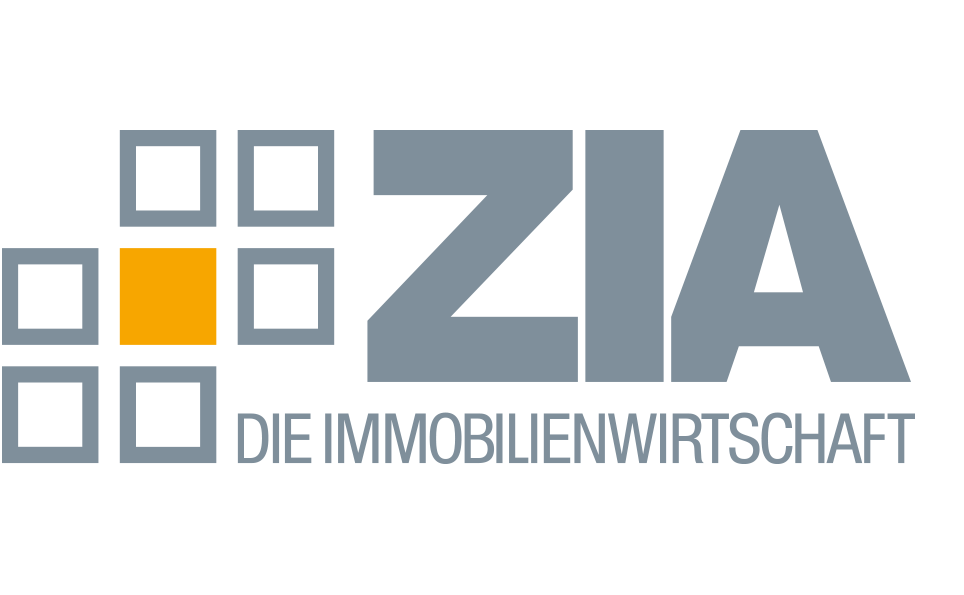Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Immobilienklima
Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird jedes Jahr vom Immobilienweisen Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld im Rahmen des Frühjahrsgutachtens eingeschätzt und auf die Immobilienwirtschaft bezogen. Lesen Sie hier die Zusammenfassung für die Ausgabe 2024.
Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in Deutschland im Jahr 2023 gegen über dem Vorjahr um 0,3% gesunken. Zu Beginn des Jahres war die Prognose des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zwar mit 0,2% optimistischer, in seinem Jahresgutachten im Herbst revidierte er sie allerdings auf 0,4%. Er begründete diese Änderung mit dem Rückgang des öffentlichen Konsums infolge auslaufender coronabedingter Hilfen, den kriegsbedingt hohen Energiepreisen, der Konsumzurückhaltung und den Realeinkommenseinbußen der privaten Haushalte wegen Inflation sowie der restriktiveren Geldpolitik. Letztere führte zu einem nachteiligen Finanzierungsumfeld und bremste die Investitionstätigkeit, vor allem im Baubereich, spürbar ab. Trotz geopolitischer Risiken und wirtschaftspolitischer Unsicherheit dürfte es im laufenden Jahr allmählich zu einer gesamtwirtschaftlichen Aufhellung kommen.
Der Arbeitsmarkt blieb trotz der schwachen Konjunktur beständig. Die Zahl der Erwerbstätigen lag Anfang 2023 noch um 1,0% über dem Vorjahreswert. Sie stieg weiter an, jedoch mit stetig abnehmender Dynamik. Im September erreichte sie erstmals die 46-Millionen-Schwelle und stagnierte schließlich gegen Ende des Jahres. Für das Gesamtjahr 2023 wird die Zunahme der Zahl der Erwerbstätigen auf +333.000 (+0,7%) geschätzt, deutlich weniger als noch im Vorjahr. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote schwankte im Jahr 2023 zwischen 2,9% und 3,2%. Noch konnten die drückenden Effekte des demo grafischen Wandels durch eine gestiegene Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung und die positiven Effekte der Zuwanderung ausländischer Erwerbstätiger in den deutschen Arbeitsmarkt ausgeglichen werden. Die Aussicht auf die kommende Entwicklung ist allerdings gedämpft. In der Baubranche könnte es zum ersten Beschäftigungsverlust seit der Finanzkrise 2008 kommen.
Die Inflation blieb 2023 zunächst hoch. Sie stand im Januar bei 8,7% (Verbraucherpreisindex, VPI) im Vergleich zum Vorjahresmonat und lag durchschnittlich bei mehr als 7% im ersten Halbjahr. Es folgte ein Rückgang bis Oktober 2023 auf 3,8%, somit erstmals auf ein Inflationsniveau wie vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. Im Dezember stieg sie wieder leicht auf 3,7%, hauptsächlich aufgrund von Basiseffekten infolge der Soforthilfe-Maßnahmen der Bundesregierung. Im Jahresdurchschnitt 2023 lag die Inflationsrate bei 5,9% und damit deutlich unter der Teuerung des Vorjahres von 7,9%. Bei den Baupreisen zeigt die Stagnation in den letzten beiden Quartalen eine Abkühlung der Preisentwicklung, die sich durch die sinkende Baunachfrage wohl weiter fortsetzen dürfte. Für 2024 prognostizieren die Institute im Mittel eine Inflation von 2,68%.
Die Finanzierungsbedingungen haben sich weiter verschärft. Die EZB hat ihre restriktivere Geldpolitik wie erwartet fortgeführt. Nach der letzten Zinserhöhung im Dezember 2022 hob sie den Leitzins im Februar 2023 von 2,50% auf 3,00% weiter an. Im März folgte der nächste Schritt auf 3,50%, im Mai eine kleinere Anpassung auf 3,75%. Die Inflation blieb hoch und so ging es im Juni und August auf 4,00% bzw. 4,25%. Im September erfolgte die letzte Anhebung für 2023 auf 4,50%. Seitdem stehen die Zinssätze für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte, die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagenfazilität nach steilem Anstieg bei 4,50%, 4,75% bzw. 4,00%. Der EZB-Rat hält diese Zinsniveaus für vorerst ausreichend, um die Inflation mittelfristig wie der auf den Zielwert von 2% zurückzubringen. Eine schnelle Senkung der Leitzinsen ist aber nicht zu erwarten.
Die Kreditvergabe an Unternehmen und private Haushalte entwickelte sich 2022 noch dynamisch, mit einem Wachstum von 6,6% im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2023 brach der Trend ab. Die Vergabe von Wohnungsbaukrediten stieg in den ersten drei Quartalen 2023 im Durchschnitt nur noch weniger als 0,5% gegenüber den jeweiligen Vorquartalen. Die hohen Zinsen und die generelle Konjunkturschwäche belasten die privaten Haushalte und erschweren ihnen kreditfinanzierte Immobilienkäufe. Im ersten Halbjahr 2023 wurden nur halb so viele Wohnimmobilienkredite an private Haushalte vergeben wie noch im Vorjahr.
Die Bauwirtschaft ist seit 2022 durch Lieferengpässe, gestiegene Baupreise, den anhaltenden Fachkräftemangel, die Inflation und hohe Zinssätze erheblich belastet. Zusätzlich sinkt die Nachfrage und führt zu einem alarmieren den Einbruch der Auftragseingänge im Bereich des Wohnungsbaus. Bauvorhaben sind nicht mehr rentabel, die Fertigstellungszahlen sinken. Das Geschäftsklima im Wohnungsbau liegt auf dem historischen Tiefstand seit Beginn der Erhebung 1991. Die Stornierungswelle im Wohnungsbau erreichte 2023 ihren Höchststand, als 20,7% der Unternehmen von stornierten Projekten berichteten. Zum Ende des Jahres 2023 meldete fast jedes zweite Unternehmen im Wohnungsbau einen Auftragsmangel. Die Gefahr für Liquiditätsausfälle ist gestiegen, was auch für die Finanzstabilität problematisch werden könnte. Lediglich das Ausbaugewerbe konnte im zweiten Quartal 2023 von einer gestiegenen Nachfrage im Bereich energetischer Sanierung profitieren. Angesichts negativer Geschäftserwartungen und ungünstiger Rahmenbedingungen wird der Trend der sinkenden Baugenehmigungen und Baufertigstellungen in den kommenden Jahren anhalten, das Wohnungsmarktangebot nachlassen und den Druck auf die Mieten erhöhen. Zur Anregung der Investitionstätigkeit kann die Wirtschaftspolitik angebotspolitische Maßnahmen angehen, die zugleich bei knappen öffentlichen Mitteln umsetzbar sind: Steuerentlastung (Grunderwerbsteuer und Grundsteuer) und Reduktion der Regulierungskosten (Abbau der Vielheit von regulatorischen Einzelmaßnahmen im Wohnungsbau).
Mehr Informationen
Kontakt